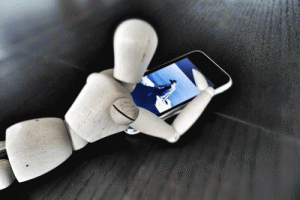Medienökologie – reloaded again
Neue Medien können kognitive und kreative Fähigkeiten unterstützen, den Erfahrungs- und Aktionsradius bereichern, Möglichkeiten der Selbstdarstellung und Partizipation eröffnen – müssen sie aber nicht (vgl. Gräßer, Hagedorn 2012). So haben sich schon früh Medien- bzw. Kommunikationsökologen mit den sozial(psychologisch)en Kosten der (medial vermittelten) Kommunikation auseinander gesetzt, Dehumanisierungs- und Vereinsamungstendenzen beklagt, mögliche Strategien für den Umgang mit der herauf ziehenden Informationsüberlastung entwickelt usw. Nach rund fünf Jahren Smartphone, zwanzig Jahren Handy, zwanzig Jahren Internet (siehe interaktive Grafik) und dreißig Jahren PC ist „die digitale Revolution“ aber eigentlich erst im vollen Gange und wird mit ihren Folgen sichtbar. Dabei häufen sich aktuell die Negativbefunde. Zu Recht?
Verflachungstendenzen und Auswirkungen auf unser Denken
Im Interview erklärt die US-Soziologin und Technologieexpertin Sherry Turkle (Gräßer, Hagedorn 2012, S. 33). „Wir erlauben dem Internet sowie den modernen Technologien in unsere Privat- und Intimsphäre vorzudringen – und zwar zu hohen Kosten. Unser Leben ‚online‘ verführt zu einer oberflächlicheren, emotionell fauleren Art von Beziehungen. Diese Schein-Bindungen suggerieren uns, sie seien mit niedrigem Risiko und Aufwand verbunden – und wirken dadurch attraktiv auf uns. Auch wecken sie den Eindruck, man könnte stets auf sie zugreifen.“
Damit erliegen wir der Illusion, dass wir durch die neuen Techonologien miteinander verbunden sind, ohne uns den bisweilen mühevollen Herausforderungen von Intimität und Kommunikation stellen zu müssen. Und überhaupt sind wir so beschäftigt mit der Pflege der oberflächlichen Bekanntschaften, dass wir den Aufbau tiefer Bindungen beiseite lassen würden, so die US-Soziologin und Technologieexpertin. Das gipfelt darin, dass wir auf die Dauer mit dem Gefühl der Einsamkeit zurück bleiben (ebenda). Sherry Turkle ist also der Meinung, dass die weltweite Vernetzung – ein von vielen immer wieder in den Vordergrund gerücktes Potenzial – nicht nur unsere sozialen Beziehungen verflachen lässt, sondern dahinter sogar eine neue Form medialer Vereinsamung lauert. Hierbei stützt sie sich auf Einzelfallanalysen, eigene Projekterfahrungen, oftmals Interviews, nennt aber keine breiter angelegten Studien. Auch wenn ihre Ananlyse stimmen mag (oder auch nicht), verliert sie dadurch natürlich an Glaubwürdigkeit.
Weniger das (Einsam-)Fühlen, sondern eher das Denken untersucht hingegen der Neurobiologe Manfred Spitzer in seinem neuen Buch „Digitale Demenz“ (2012, demnächst bei Droemer Knaur). Seine Diagnose (im Interview mit dem ARD-Magazin „titel, thesen, temperamente“): Die Nutzung von Smartphones, Computern, Spielkonsolen und Navigationssystemen erleichtern uns nur vordergründig das Leben, langfristig schadeten sie Körper und Geist: „Jeder Computer nimmt uns geistige Arbeit ab, und das heißt, dass geistige Arbeit nicht im Kopf passiert, und wenn man weiß, dass das Gehirn immer dann lernt, wenn es gebraucht wird, dann ändern sich die Synapsen. Wir machen die Gehirnbildungsprozesse damit kaputt und wir werden die Quittung bekommen in einigen Jahrzehnten.“ Sein Urteil wird von diversen Studien gestützt, besser gesagt: verifiziert. Aber, Spitzer zitiert ausschließlich Studien, die seine Negativdiagnose stützen. Mögliche Trainigseffekte, wie sie andere diagnostizieren, spielen keine Rolle.
Mit seiner Argumentation ist Spitzer nicht allein. Für Frank Schirmmacher lautete die Frage des Jahres 2010 bereits: „Wie hat das Internet Ihr Denken verändert? Im Kern der Diskussion steckt die Frage des Wissenschaftshistorikers George Dyson: ‚Sind der Preis für Maschinen, die denken, Menschen, die es nicht mehr tun?’“ Dabei scheint er einen Nerv der Gesellschaft getroffen zu haben – man erinnert sich an zahlreiche Talkshoweinladungen (Mehr zu Frank Schirrmachers Thesen auch hier und hier. Eine Replik von Sascha Lobo steht bei Spiegel Online).
Verpassensängte und Abhängigkeitserscheinungen
Verlernen wir also das Denken? Psychologen kommen hier zu anderen Diagnosen. So berichtet die ZEIT über das moderne „On-Leid“: “Nomophobie” (abgeleitet von engl. „no mobile phone“) bezeichnet die Angst, ohne Mobiltelefon zu sein. Einer Umfrage der britischen Post zufolge würde jeder Zehnte unruhig, wenn das Telefon auch nur ausgeschaltet ist. „Mediziner ordnen das überzogene Kommunikations- und Informationsbedürfnis in die Gruppe der Suchterkrankungen ein. Die Symptome sind ähnlich wie die von Alkohol- und Nikotinsucht, darunter starkes Verlangen, innerer Zwang, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen,“ heißt es in der ZEIT weiter.
„iPhone also bin ich“ titelt der SPIEGEL Anfang Juli (27/2012): „Kein anderes Produkt hat die Menschheit so radikal verändert wie das Smartphone. Es macht frei, aber auch abhängig.“ Aber wann beginnt die Sucht? Gibt es sie wirklich? „Die Hardware wird dafür nicht entscheidend sein“, sagt Bert te Wildt, Facharzt an der Uni-Klinik-Bochum und Vorsitzender des Fachverbands Medienabhängigkeit, im Interview (ebenda, S. 70). Erst das Internet liefere jenen Kitt, der nun alles verbindet und jede dialogfähige Kaffeemaschine zum dialogfähigen Gegenüber macht. Bert te Wildt weiter: „Da wurde eine Beziehungsdimension ins Mediale eingeführt, und die kann uns abhängig machen.“
Machen uns Medien also auch noch krank (und abhängig)? Wenngleich sie beunruhigen, muss man auch bei diesen Diagnosen vorsichtig sein. Sicher ist ein Gespür für das „zu viel“ Teil der Lösung.
Kompetente Nutzung fördern
Wie eingangs schon gesagt: Neue Medien können kognitive und kreative Fähigkeiten unterstützen, den Erfahrungs- und Aktionsradius bereichern, Möglichkeiten der Selbstdarstellung und Partizipation eröffnen, wenn man sie kompetent einsetzt. Der Begriff der Medienkompetenz beschreibt in diesem Zusammenhang die zu entwickelnden instrumentellen bzw. kritisch-reflexiven Komponenten eines Individuums im Sinne von Fähig- und Fertigkeiten. Gemeint ist die Fähigkeit zur eigenbestimmten, sinnvollen, effektiven und reflektierten Nutzung technischer Medien. Lebensqualität beschreibt hierbei das “Wozu” der Medienkompetenz, wie schon andernorts erläutert. Ihre Steigerung ist das Ziel.
Eine intakte Umwelt sowie stabile Sozialbeziehungen scheinen hierfür zwingend, weshalb ökologische Aspekte dabei unbedingt mit einzubeziehen sind (vgl. Gräßer, Hagedorn 2012). Neben einer Förderung der rezeptiven und produktiven Informationskompetenz, Formen der ästhetischen Medienbildung und der kreativen Auseinandersetzung mit den uns umgebenden medialen Umwelten, gehören deshalb zur inhaltlichen Ausgestaltung von Medienkompetenz auch Aspekte einer gesunden Mediennutzung – so viel sollte klar geworden sein -, damit ein Gespür für Verflachungstendenzen und Verpassensängte sowie das angesprochene „zu viel“ nicht verloren geht. Nur so sind Medien eine Bereicherung.
Was das praktisch bedeutet, bedeuten kann, beschreibt aktuell eine Neuerscheinung aus der Reihe IM BLICKPUNKT. Wie können oder sollen wir ökologisch und sozialverantwortlich Medien nutzen? Wie Kommunikation gestalten? Wie Gesundheitsgefährdungen und Umweltbelastungen vermeiden? Die Broschüre IM BLICKPUNKT: Medienökologie greift diese Fragen auf und gibt Hinweise, was der oder die Einzelne konkret tun kann, um medienökologisch bewusst zu agieren. IM BLICKPUNKT: Medienökologie ist demnächst online unter: www.grimme-institut.de/imblickpunkt